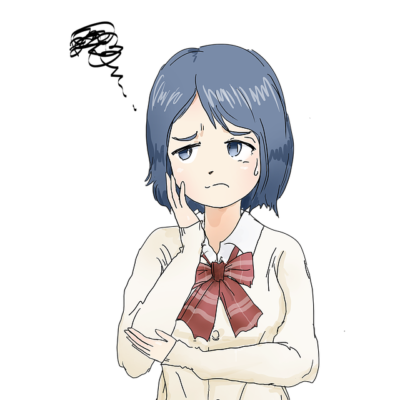Maria ist eine fachlich perfekte Notfallsanitäterin
Maria wischt sich trotzig über die feuchten Augen. Zusammengesunken sitzt sie vor mir in meinem Notarztzimmer und schluckt vernehmbar.
“Ich hab es mir doch gedacht. Ich hatte ja die Lanzette auch schon in der Hand.” Ihre letzten Worte gehen in ein ersticktes Flüstern über.
Sie ist extra nach ihrer Schicht zu mir gekommen, um sich zu entschuldigen. Und offenbar auch, um ihren Gefühlen Raum zu geben, denke ich mir, als ich aufstehe, um ihr ein Tuch aus dem Papierspender zu rupfen, was Maria mit einem wütenden Blick quittiert, als sie meine Absicht erkennt. Ich entscheide mich schnell um.
“Es wird einen guten Grund gegeben haben, dass du den Blutzucker nicht gemessen hast”, sage ich, als sie nicht weiter redet. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Maria über einen vergleichsweise großen Ehrgeiz und ein großes theoretisches Wissen verfügt. Denn in den vielen Praktikumstagen, die sie bei mir auf dem NEF absolviert hatte, musste sie sich in den Einsätzen nicht lange mit den theoretischen Grundlagen befassen, sondern setzte die erlernten Algorithmen in ihrer ruhigen, konzentrierten Art so gekonnt in der Praxis der Patientenversorgung um, dass sie schon den Kopf frei hatte für weiterführende Gedanken und organisatorische Aspekte. Die Zusammenarbeit mit ihr war immer sehr angenehm.
Was also konnte passiert sein, dass diese überdurchschnittlich begabte und interessierte Notfallsanitäterin die Basics der Patientenversorgung missachtet hatte und nun so elend bei mir sitzt?
Eine neue Herausforderung auf dem RTW
“Ich hab es einfach nicht geschafft”, stellt sie fest. “Die hatten alle recht, die gesagt haben, dass ich das Beifahren nicht schaffe…”, presst sie heraus und verschluckt den Rest des Satzes.
„Erzähl doch einfach mal von vorne“, bitte ich sie.
„Also gut,“ beginnt sie und atmet tief ein, „eigentlich hab ich mich auf meine erste Schicht mit Matti gefreut. Er hat so viel Erfahrung wie fast niemand hier und wir haben uns auch immer gut verstanden, als ich Praktikantin war.“ Maria schüttelt sachte ihren Kopf
„Als wir uns heute Früh zur Schicht getroffen haben, hat er schon aufgelacht, als er mich gesehen hat und irgendeinen Kommentar abgelassen, so etwa, ob die neue NotSan ihm heute das Patientenretten zeigen will.“
Matthias kenne ich von den gemeinsamen Einsätzen recht gut, er war wirklich schon damals ein alter Hase gewesen, als ich mit dem Notarztfahren überhaupt erst begonnen hatte. Ich habe ihn immer freundlich und fachlich zuverlässig erlebt und frage mich jetzt umso mehr, was heute zwischen den beiden falsch gelaufen war.
Unter kritischer Beobachtung
„Die Einsätze liefen dann auch ganz gut, ich hab die Patienten immer so gut versorgt, wie ich konnte. Natürlich war nicht alles perfekt, klar, vieles kann und weiß ich einfach nicht.“
Maria schaut mich auf ihre Art hilflos an und ich kann mir anhand des Gesichtsausdrucks gut vorstellen, wie sie sich nach jedem Einsatz gefühlt hat. Und gleichzeitig ist mir klar, dass dieses Gefühl wahrscheinlich jedes Mal unbegründet war.
„Matti hat nicht viel gesagt, nur, ich würde zu lange zum Schreiben der Protokolle brauchen und sich einmal nach der Patientenübergabe für mich wegen irgendwas entschuldigt, als er meinte, ich merke das nicht.“
Sie zuckt fast unmerklich mit den Schultern.
„Ich bin jung und unerfahren, wenn Matti das sagt, wird er recht haben.“ Da ist nur Überzeugung in ihrer Stimme, Ironie oder Sarkasmus versuche ich vergeblich herauszuhören.
„Ach, Unsinn!“, sage ich daher. „Du bist fachlich sehr gut und viel weiter, als du müsstest. Als wir zusammengearbeitet haben, hast du die Patienten super versorgt, das weißt du doch noch, oder? Diese Fähigkeiten hast du immer noch, die verlierst du doch nicht mehr.“
Maria schaut mir mit dem Blick eines Kindes entgegen, dem man einen Trostpreis überreicht.
Sie blickt zu Boden. „Das war Glück und Zufall. Manchmal denke ich mir, ich dürfte meine Abschlussprüfung gar nicht bestanden haben, weil ich doch bestimmt auch aus Glück oder Mitleid die einfachste Prüfung bekommen habe. Als mich die anderen damals danach gefragt haben, hab ich mich schon geschämt.“
Plötzlich klopft es an der Tür und wir blicken uns missmutig an.
Mehr Hilfe als erwünscht
„Ja?“, sage ich, doch Mattis Kopf schaut schon durch die geöffnete Tür.
„Servus! Ich hoffe, ich störe nicht“, sagt er im Hereinkommen zu mir und streckt mir die Hand entgegen. Ich erhebe mich zur Begrüßung.
„Da ist ja meine Chefin!“, zwinkert er Maria zu. „Sie macht das schon ganz gut, kann man nicht anders sagen, bald muss ich ihr nicht mehr auf die Finger schauen, damit sowas wie gerade nicht mehr passiert.“, meint er in meine Richtung. Mattis Hände stecken in seinen Hosentaschen und flankieren so seinen Bauch, über dem die gar nicht mehr zeitgemäße Rettungsdienstjacke aus Baumwolle spannt.
„Ich hab jetzt das Auto alleine fertig gemacht, Kleine. Keine Ahnung, wie lange das her ist, dass ich das zuletzt machen musste. Und das ist nichts, woran ich mich gewöhnen will.“
Matti lacht jetzt, aber Maria schickt mir einen schuldbewussten Blick herüber.
„Wenn du mit dem Kaffeekränzchen hier fertig bist, sollten wir zum Schichtwechsel fahren.“
„Gib uns bitte noch ein paar Minuten“, bitte ich ihn, bevor Maria etwas sagen kann. Er nickt, dreht sich auf seinen offenen, abgenutzten Rettungsdienststiefeln um und verlässt das Zimmer.
„Maria, ich weiß, dass du unter normalen Umständen keinen Patienten mit ausschließlich einem Unterzucker als Schlaganfall in die Stroke Unit fährst.“
„Heute schon. Und ich schäme mich so.“ Eine der fachlich besten mir bekannten NotSan sinkt noch ein Stückchen mehr in sich zusammen.
Time is brain but sometimes brain needs time
„Sag mir doch mal, was die Routine durchbrochen und die Blutzuckermessung verhindert hat.“, bitte ich Maria.
„Während ich die Patientin verkabelt und neurologisch untersucht hab, hat Matti schon mit der Leitstelle telefoniert und ein Stroke-Bett bestellt.
Für ihn war es eine so klare Sache, dass er die Patientin nur schnell in den RTW bringen wollte. Er sagte dem Sohn der Patientin und mir, wie schnell wir nun handeln müssten. ‚Time is brain‘, ‘wir müssen schnell ins CT‘ und so weiter. Meinen Einwand, dass wir erst schnell die Messungen abarbeiten müssen, ignorierte er völlig. Der Sohn der Patientin bekam die Uneinigkeit zwischen uns natürlich mit. Das war mir sehr unangenehm. Er half dann aber schließlich Matti, seine Mutter in den RTW zu tragen, obwohl ich noch nicht mal einen Zugang legen konnte. Ich hab deshalb einige Male vergeblich versucht, Matti zu bremsen. Doch er hat mich gar nicht wahrgenommen, während er den Beginn des Einsetzens der Symptome und andere wichtige Eckdaten der Vorgeschichte und Vorerkrankungen abgefragt hat.“
So wie Maria die Situation beschreibt, sehe ich Matti genau vor mir, in Aktion, zielstrebig und unbeirrbar. Und auch Maria, medizinisch präzise und besorgt, aber praktisch machtlos. Sie fährt fort zu erzählen.
„Als ich der unruhigen, aber nicht wachen Patientin im RTW gerade den i.v.-Zugang gelegt hatte, höre ich Matti vorne dieses Klinikum hier als Ziel bestätigen. Mir war die ganze Zeit bewusst, dass wir zu wenig gemessen, untersucht und daher wahrscheinlich auch zu wenig die Patientin versorgt hatten, um mit ihr auf ‚Stroke‘ zu fahren. Dann ist der RTW plötzlich angefahren und ich hab geschrien, die Nadel der Verweilkanüle noch in der Hand. Der bremsende RTW hat mich fast von alleine nach vorne getragen, wo ich Matti angeblafft und die spitze Nadel automatisch, aber im Nachhinein betrachtet blöderweise, in den Sicherheitsbehälter abgeworfen hab.“
Interessiert beobachte ich zum ersten Mal überhaupt, wie sich eine Zornesfalte auf Marias Stirn bildet und nehme an, dass Matti diese heute bereits einmal zu Gesicht bekommen hat.
„‚Sorry, ich dachte, du sitzt schon. Komm, setz dich hin, wir fahren jetzt‘, hat er gesagt. Ich sag ihm, dass wir noch lange nicht fertig sind. Und frage, wo der Notarzt bleibt. Er antwortet dann einfach kurz: ‚Wir fahren ohne, hier geht’s um Zeit.‘
Das war zu viel für mich. Ich war medizinisch verantwortlich auf dem RTW, aber der erfahrene Kollege hat mich ignoriert und bevormundet. Ich hab kein Mittel gefunden, mich durchzusetzen, die Patientin war schlecht versorgt und meine Hoffnung auf eine Unterstützung durch einen Notarzt verpufft.
Mir sind die Tränen gekommen. Ich konnte das alles nicht mehr allein, als der RTW losgefahren ist, ich war zu schwach.” Maria schürzt die Lippen und zuckt leicht mit den Schultern.
“Dann hab ich gemerkt, dass ich auch noch die Nadel verworfen hatte, aus der ich den Blutzucker messen wollte. Ich hab versucht, die Patientin mit der Lanzette zu stechen und den Zucker wenigstens noch vor der Einlieferung zu messen, aber die Fahrt war zu unruhig und meine Hand hat ohne Ende gezittert.
Ich hab irgendwie schon damit gerechnet, dass wir uns blamieren. Dass ich mich blamiere.”
Ende?
“Denn auch wenn ich es anders hätte machen wollen, hätte ich dafür sorgen müssen, dass es auch anders gemacht wird. Das war mein Fehler.”
Maria schaut mich mit glasigen Augen fest an.
“Ich bin zu dir gekommen, um dir persönlich zu sagen, dass ich aufhören will. Ich halte diesem Druck nicht stand. Und ich verdiene das Vertrauen nicht, das du und meine anderen Freunde in mich gesetzt haben. Es tut mir leid. Bisher hatte ich Glück, aber es ist eben doch mehr verlangt, als ich bin und kann.”
Der Piepser an Marias Hose pfeift los. Ein Alarm. Mit dem pünktlichen Schichtwechsel wird es wohl nichts. Matti wird nicht begeistert sein.
Was ist das Impostor-Syndrom?
Betroffene sind oft sehr erfolgreich, halten aber nicht ihre eigenen Fähigkeiten und ihre Leistung für die Ursache dieses Erfolgs. Stattdessen machen sie äußere, schlecht fassbare Umstände wie Glück oder Zufall dafür verantwortlich.
Wird ihnen von anderen Personen in Form von Lob oder Anerkennung demonstriert, dass sie von außen als kompetent und tüchtig wahrgenommen werden, dann können sie das nicht akzeptieren. Das geht sogar so weit, dass Personen mit Impostor-Syndrom eine Angst entwickeln können, es könnte auffliegen, wie vermeintlich wenig Ahnung sie haben und sie dann gewissermaßen als Hochstapler angesehen werden. Daher wird das Impostor-Syndrom auch Hochstaplersyndrom genannt. Dies ist leider eine sehr unglückliche Bezeichnung, weil sie das Gegenteil davon aussagt, was bei den Betroffenen eigentlich gemeint ist. Das gleiche gilt auch für den englischen Begriff, denn “Impostor” bedeutet “Betrüger”.
Welche Rolle spielt das Impostor-Syndrom im Rettungsdienst?
Es gibt wie in allen Berufen auch im Rettungsdienst Menschen, die durch viel Wissen, Ehrgeiz und Talent herausragende Leistungen erbringen.
Es liegt auch in der Natur des Rettungsdienstes, dass die Rettungsdienstler öfter als in manch anderen Berufen in Situationen geraten, in denen sie kritische Entscheidungen treffen müssen. Entscheidungen, die Leben von Patienten verändern, manchmal sogar retten können.
So heldenhaft aber die Leistung von außen betrachtet wird, hat der vom Impostor-Syndrom betroffene Rettungsdienstler immer das Gefühl, selbst nicht maßgeblich dazu beigetragen zu haben.
Wie im Beispiel oben beschrieben, kann das zu einem ausgeprägten Gefühl des Versagens und der Insuffizienz ausarten.
Die Besonderheit im Rettungsdienst ist sicherlich für einen Menschen, der ein Impostor-Syndrom zeigt, dass er hier täglich mit tatsächlich ereigneten oder ausgeschmückten Rettungstaten konfrontiert wird, mit denen er seine eigene Leistung selbst vergleicht. Das ist in anderen Berufen möglicherweise weniger der Fall.
Wie kann ich das Impostor-Syndrom bei mir oder anderen erkennen?
Grundsätzlich ist es klar, dass man als Neuling oder überhaupt in einer neuen Situation sich nicht sicher sein kann, dass man genügend Wissen, Erfahrung oder Umsicht mitbringt, um Optimales zu leisten.
Fast nichts ist schlimmer und gefährlicher, als ein übermotivierter Anfänger ohne die notwendige Bescheidenheit und fehlendem Respekt der Notfallsituation gegenüber.
Insofern ist Selbstreflektion und eine gesunde Aufmerksamkeit der eigenen Leistung gegenüber wichtig und tatsächlich auch für die Leistungsverbesserung entscheidend.
Problematisch und krankhaft wird die Situation, wenn sich die Wahrnehmung der eigenen Leistung asymmetrisch und selektiv auf negative Aspekte beschränkt und den positiven Anteil ausblendet. Typischerweise findet dann eine Verallgemeinerung statt, ein einzelner Fehler führt zu einem generellen Urteil über die eigene Leistungsfähigkeit.
Dieses Prinzip ist eigentlich einfach zu erkennen, wenn es auftritt, bei sich selbst und bei anderen.
Das Impostor-Syndrom erkennt man, indem man in Situationen, die den Anschein erwecken, dass der Betroffene seine eigene Leistung geringer bewertet als viele andere Fachkundige, darauf überprüft, ob oben beschriebener subjektiver Ausblende- und Verallgemeinerungseffekt stattgefunden hat.
Was kann man gegen das Impostor-Syndrom im Rettungsdienst tun?
Ein wichtiger Schritt gegen die häufig selbstzerstörerischen und deprimierenden Effekte des Impostor-Syndroms ist die Verbreitung der Information über seine Existenz, etwa über das Teilen von Artikeln wie diesem hier in den entsprechenden Fachkreisen.
Ich persönlich arbeite viel lieber mit Kollegen im Rettungsdienst zusammen, deren Ego nicht gleich vor Selbstüberschätzung platzt, sondern die ihr Selbst in der Patientenversorgung nach hinten stellen. Daher halte ich es für wichtig, dass diese vielleicht für das Impostor-Syndrom anfälligeren Personen nicht von der Arroganz der im Rettungsdienst zweifellos zahlreich vorhandenen Aufschneider verdrängt werden.
Was kann man konkret gegen das Impostor-Syndrom tun?
- Aufmerksam sein und das Impostor-Syndrom erkennen (s.o.),
- Ein Vieraugengespräch oder eine Thematisierung in der Gruppe kann helfen, die Wahrnehmung des vom Impostor-Syndrom Betroffenen zu korrigieren und das Gefühl der Minderwertigkeit zu vertreiben,
- Gegenseitiges Feedback während und nach Einsätzen, hierbei insbesondere gelungene Leistungen erwähnen und loben,
- Ansprüche analysieren und ggf. der Realität anpassen: sind die eigenen Ansprüche viel höher, als die Erwartung in der realen Situation, kann dies das Impostor-Syndrom nähren,
- Etiketten erkennen und entfernen: Der Betroffene wurde mit einer Eigenschaft (z.B. “dumm”) oder einer Bezeichnung (“die Kleine”) versehen und kommt nicht aus der so zugewiesenen Rolle heraus,
- Freunde einweihen und so Unterstützer finden,
- Erfolgstagebuch führen, um auf seine Stärken zu fokussieren.
Was aus Maria geworden ist
Maria und ich setzten unser Gespräch auf meine Initiative hin bald fort und ich erzählte ihr von meinen unsicheren Aktionen und Fehlern am Anfang meiner Zeit, als ich erstmals Verantwortung tragen musste. Ich verglich meinen damaligen Kenntnis- und Könnensstand mit ihrem jetzigen und machte ihr klar, dass der Unterschied nicht groß sein konnte.
Wir analysierten gemeinsam ausführlich die rationalen Aspekte ihrer Leistungsfähigkeit und definierten ihre Stärken. Und indem sie den Mechanismus des Impostor-Syndroms durchschaute, war Maria bald in der Lage, auch ihre Minderwertigkeitsgefühle in diesen bestimmten Situationen viel besser zu kontrollieren.
Sie blieb dem Rettungsdienst als eine der besten Notfallsanitäterinnen treu und lernte immer besser, ihre Leistungen auf sich selbst zu beziehen.
Ich suchte auch das Gespräch zu Matti, doch stieß ich hier nur auf Unverständnis bezüglich des von seiner Seite sehr problematischen Verhaltens im Team. Das einzige Zugeständnis war im Hinblick auf die fehlerhafte Patientenversorgung zu erreichen, die aber als Einzelfall abgetan wurde.
Fazit
In seinen verschieden starken Ausprägungen ist das Impostor-Syndrom ein häufiges Phänomen, das vor allem auch im Rettungsdienst wegen der persönlichen Verarbeitung von eigenen Leistungen, von denen manchmal das Schicksal von Menschen abhängt, eine große Rolle spielt. Es kann zu Selbstzweifeln, Depression und letztlich durch Überlagerung auch tatsächlich zu schlechten Leistungen führen.
Es ist daher wichtig, das Impostor-Syndrom bei sich selbst und bei anderen zu erkennen. Es gibt wirksame Strategien, es zu bessern.
Bertrand Russell sagte: „Die grundlegende Ursache der Probleme ist, dass die Dummen todsicher und die Intelligenten voller Zweifel sind.“ und trifft damit den Kern der Sache.
In diesem Sinne: wen auch das weit verbreitete, gegenteilige Extrem des Impostor-Syndroms interessiert – der Dunning-Kruger-Effekt – , den erwartet ein in Bälde erscheinender, spannender Blogbeitrag hierzu!